hunziobelix
Till Deaf Do Us Part
Kurz vor dem Start ins Wochenende:
Anhang anzeigen 202940
"No more Color" ist - wie eigentlich alle Alben der Schweizer - ein kleines Meisterwerk. Wie nennt man diese Musikrichtung doch gleich - "Techno-Thrash?" Na, ist im Wesentlichen auch völlig egal.
Der Opener "Die by my Hand" ist unmittelbar in die Fresse, komplex, progressiv, zig Wendungen, hart und brutal. Keine Frage, eine Eröffnung, wie sie im Bilderbuch steht. Dazu ein Chorus, der einfach durch die förmlich rausgerotzten 3 Worte unmittelbar auf die 12 geht und nur danach schreit, bei Liveaufführungen mitgegrölt zu werden. "No need to be Human" beginnt bluesig: ein heavy gespieltes Eingangsriff, ehe das Stück in einer thrashig-progressiven Eskapade expoliert, dieses Mal garniert mit einem eingängigen Refrain - nahezu perfekt. Zum Ende hin kommt noch eine etwas ruhigere Passage nebst Gitarrensolo zum Tragen - also auch hier regiert die Abwechslung - und das in knapp viereinhalb Minuten.
"Read my Scars" bietet dann wieder Thrash-Metal vom Feinsten: alle Trademarks der Richtung enthalten, schweres Riffing, auch hier wieder zig Breaks, ein galoppierender Thrash-Track, der Refrain ist auch hier wieder eher geshoutet. "D.O.A" setzt die Linie des Vorläufers unmittelbar fort, Richtung Chorus ein wenig Temporeduktion, hier ein eingestreutes Gitarrensolo feinster Qualität - nach wie vor keinerlei Qualitätsabfall. "Mistress of Deception" nimmt ein wenig das Tempo raus, dafür regiert feinste Gitarrenarbeit. Die eher im Midtempo angesiedelte "Ballade" (wenn man so will im Kontext des Albums gesehen) bietet allein in diesem Bereich, eine unglaubliche Vielfalt an Gitarrensounds, von leicht orientalisch angehaucht bis klassisch metalriffend, von getragen bis virtuos soliert, teils klassisch rockig sogar - alles drin. Dazu ein Refrain, der trotz allem dafür sorgt, dass hier nicht nur ein instrumentales Massaker vorgetragen wird.
Danach geht es in den "Tunnel of Pain": Thrash as Thrash can. Erneut viereinhalb Minuten Abfahrt mit zahlreichen Wendungen und Breaks, dazu der einfach passende, fiese Gesang - funktioniert komplett ohne Growls, dafür aber aggressiv geshoutet ohne dabei diesen typischen "Pantera"-Charakter zu entwickeln. Schon eine kleine Kunst für sich und in Verbindung mit der Musik regelrecht optimal. Zur Mitte des Tracks hin baut man schleppende Elemente inklusive Gitarrensolo ein, was dem Ganzen noch einmal eine weitere Aufwertung verleiht. Big Business! "Why it hurts" ballert dann noch einmal fix nach vorne los, bietet eine donnernde Granate, erneut fällt die vielfältige Gitarrenarbeit auf.
Der Rausschmeißer "Last Entertainment" war sicherlich seiner Zeit voraus: ein wenig erinnert das Ganze an Gothic-Metal, eine Art Sisters-of-Mercy in Metal. Der "Gesang" ist leidlich nur gesprochen, die Instrumentalarbeit überaus virtuos. Donnernde Drums, packende Härte und dennoch eine dichte Atmosphäre - bockstark!
Hat man das Album hinter sich gelassen, dann überkommt einen unlängst der Wunsch, es gleich wieder aufzulegen. Coroner haben den Thrash-Metal seinerzeit bereits auf ein breiteres Fundament gestellt, ohne diesen seiner Brutalität und Urwüchsichkeit zu berauben. Die Band war anno 1989 ihrer Zeit klar voraus und bietet eine Form des Metal (Thrash-Prog-Heavy), der seinesgleichen sucht, denn das Erstaunliche daran: irgendwie ist das Ganze trotz der Komplexität irgendwie eingängig und verfügt über ein hohes Suchtpotential. Ich hoffe inständigst auf ein baldigst erscheinendes neues Album - und natürlich eine Tour.
Sehr schönes Review....das heisst:HÖRT MEHR CORONER.


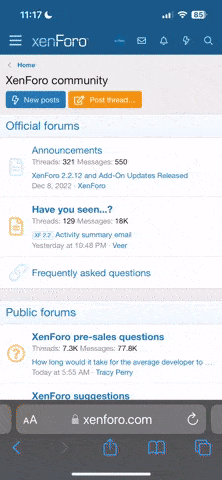




:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-6409759-1418514314-9247.jpeg.jpg)